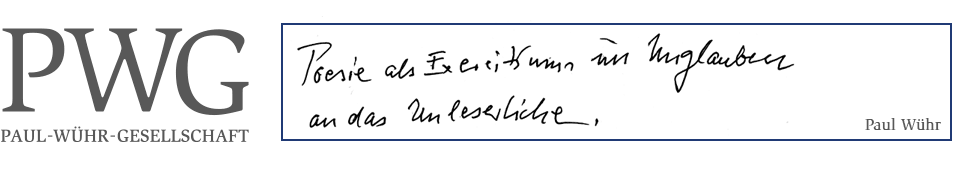Basis unserer Überlegungen sind Paul Wührs Texte der 70er und 80er Jahre: Gegenmünchen (1970), So spricht unsereiner. Ein Originaltext-Buch (1973), Grüß Gott ihr Mütter ihr Väter ihr Töchter ihr Söhne. Gedichte (1976), Rede. Ein Gedicht (1979), Das falsche Buch (1983), Soundseeing Metropolis München (1983).
Wir gehen dabei zunächst aus von So eine Freiheit, dem zweiten Teil von So spricht unsereiner, dem der Teil Preislied vorangeht und die Teile Trip Null und Verirrhaus folgen. Das Originaltext-BuchSo spricht unsereiner bezieht sich implizit von vornherein auf einen – in den frühen 70er Jahren neuen und signifikanten – literarischen Texttyp: die „dokumentarische Literatur“, die Wührs Text systematisch zugleich präsupponiert und transformiert. Laut seiner „Vorbemerkung“ (S. 6) gilt, daß die Teiltexte der vier Abteilungen des Bandes auf Tonbandaufnahmen von Sprechakten realer Personen beruhen:
Im Preislied sprechen 22 Bürger, die mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik einverstanden sind.
In So eine Freiheit sprechen 11 Frauen und Mädchen über ihre sexuellen Erfahrungen. (…) (S. 6)
Aber die Textteile reproduzieren nicht diese Bandaufnahmen, sondern jeder dieser Textteile präsentiert sich als Kombination von Elementen, die der Autor Wühr aus den Reden verschiedener realer Sprecher selegiert hat: Jede Leerzeile zeigt an, daß eine andere Person spricht. (S. 6) Jede Zeile jedes Teiltextes ist also authentische Rede eines realen Sprechers; jeder Teiltext ist hingegen eine fiktive Rede, die aus den Akten der Selektion und Kombination einer Autoreninstanz entsteht. Diese Autoreninstanz manifestiert sich in den Titeln, die sie jedem der von ihr hergestellten Teiltexte gibt und mit denen sie dem Leser eine semantische Fokalisierung vorgibt. Aus den realen Reden von 11 Frauen werden auf diese Weise in So eine Freiheit 19 fiktive Texte. Wo es sich laut Vorbemerkung in jedem Teiltext um die additive Kombination von Fragmenten aus den Reden verschiedener Sprecher in einer extratextuellen und prätextuellen Realität handeln würde, da entsteht im jeweiligen Teiltext die Suggestion eines – nunmehr fiktiven – Sprechers. Die Titel der Teiltexte etwa in So eine Freiheit legen die jeweils folgende Rede einem Subjekt in den Mund, freilich jeweils eben „unsereinem“, d. h. einem Subjekt, das sowohl insofern fiktiv ist, als es mit keinem der realen Subjekte identisch ist, als auch zugleich repräsentativ sein soll, insofern dieses eine Subjekt alle möglichen Subjekte vertritt. Zugleich findet noch eine weitere wesentliche Transformation statt: Die Autoreninstanz überführt, was Prosa der realen Sprecher war, jeweils, durch die graphische Anordnung der Aussagen, in Versedes fiktiven Sprechers. Aus realer und prosaischer Rede wird fiktive und lyrische. Wo Preislied als der erste Text des Bandes Texte der Bejahung eines politisch-sozialen Systems produziert, wobei diese Bejahung ebenfalls scheinbar problemlos und selbstverständlich ist, weil eine Bejahung überhaupt nur sinnvoll ist, wenn grundsätzlich die Möglichkeit der Verneinung gedacht werden kann, und das dargestellte System sich somit nicht des Status der Selbstverständlichkeit erfreut, da drücken die Texte der drei folgenden Teile Erfahrungen einer Frustration über eine individuelle und persönliche Situation und ein Leiden an Fremdbestimmtheit aus: Der Erfahrung eines zufriedenstellenden abstrakten Systems wird die Erfahrung eines unbefriedigenden individuellen Zustands konfrontiert. Beide Erfahrungen werden aber implizit korreliert: so, was So eine Freiheit betrifft, dadurch, daß zum einen das hier dominante Thema Sexualität sich nicht nur hier, sondern auch, nicht dominant, sowohl im Einleitungsteil Preislied als auch im Schlußteil Verirrhaus wiederfindet und daß zum anderen jene ökonomischen Kategorien, die in Preislied als konstitutive Merkmale des gegebenen Systems erscheinen, auch die Sexualität in So eine Freiheit bestimmen. Die Sexualität in So eine Freiheit und der Drogenkonsum in Trip Null erscheinen beide Male als funktionalisiert: sie sind Mittel, dank derer das Subjekt einen unbefriedigenderen Zustand in einen befriedigenderen zu transformieren sucht; die beiden Mittel erscheinen dabei als oppositionelle, aber komplementäre Alternativen: im Text schließen die beiden Möglichkeiten zwar einander aus, stellen aber partiell funktionale Äquivalente dar. So kann im Teil II die Erotik als „Rausch von Glück“ (S. 39 = 1. Text von II), im Teil III das Rauschgift als „geliebte Droge“ (S. 87 = 1. Text von III) apostrophiert werden. Zwischen diesen funktionalen Äquivalenten besteht dennoch eine Asymmetrie: In der Sexualität wird scheinbar der Andere erfahren, aber er fungiert am Ende doch nur als Katalysator betrüblicher Ich-Erfahrung; im Drogenkonsum wird scheinbar das eigene Ich erfahren, aber eben doch nur als Funktion des Personfremden, anderen, des chemischen Agens. Der unbefriedigende, individuelle Ausgangszustand erscheint beide Male implizit als eine Funktion des scheinbar befriedigenden überindividuellen Systems. Der vierte Teil schließlich artikuliert, hierin gewissermaßen die Teile II und III auswertend, Erfahrungen von Einsamkeit, Angst und Abhängigkeit, von zwischenmenschlichen Beziehungen, die grundsätzlich als Kampf erscheinen, als komplementäre Relation von Herrschaft und Unterwerfung. Die erotischen Beziehungen von So eine Freiheit repräsentieren aber, nach einer kulturell üblichen Synekdoche, die zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt; so darf denn auch eine der Sprecherinnen dieses Textes von den „scheißzwischenmenschlichen Beziehungen“ (S. 79) reden. Daß aber die Relation zwischen überindividuellem System und individuellem Zustand nur implizit bleibt, bedeutet zugleich, daß die postulierte Abhängigkeit zwischen den beiden Größen im Band eine Nullposition ist: Der Text verweigert die Anfang der 70er Jahre so naheliegende und bequeme, scheinkausale Ableitung des einen aus dem anderen; hier wie anderswo beansprucht Paul Wühr nicht den Besitz weltlichen Heilswissens. Der Text setzt das kulturelle Wissen seiner Leser voraus, daß um 1970 herum eine als relevant erfahrene Transformation des überindividuellen Systems eingetreten ist, auf die die realen extratextuellen wie die fiktiven intratextuellen Sprecher reagieren; entgegen dem aber, was der miterlebende Zeitgenosse vielleicht erwartet hätte, wird diese Transformation nicht anhand der offenkundig das System in Frage stellenden Symptome, also etwa den „Studentenunruhen“ seit 1968, sondern anhand der Veränderungen von faktischem Sexualverhalten oder zumindest theoretischen Sexualnormen und an den Problemen des Drogenkonsums illustriert – beides zwar neuartige und charakteristische Symptome der Phase, zugleich aber solche, die zumindest explizit nicht das System in Frage stellen, sondern primär eineindividuelle Veränderung anstreben. Im Gegensatz zum politischen Protest sind beide Veränderungen eher Formen der Kompensation eines als defizient erfahrenen Systems: beide Male wird individuelles Glück versprochen, bei der Sexualität im System, beim Drogenkonsum außerhalb des Systems.
So eine Freiheit gibt schon im Titel die systemintern bleibende Loslösung von tradierten normativen Zwängen vor, wobei sich der Titel als explizite Erfahrung der realen wie der fiktiven Sprecher legitimiert, insofern er in den Texten dieses Teils rekurrent wiederkehrt:
so eine Freiheit
haben wir doch noch nie gehabt
(S. 46; vgl. auch 52, 69, 74, 77, 78)
Dieser sozialgeschichtliche Transformationsprozeß, auf den unser Text Bezug nimmt, ist die – zumindest theoretische – Überwindung der Restauration tradierter Sexualnormen in der Adenauer-Ära. In So eine Freiheit erscheint nun dieser Wandel nicht als schon erfolgreich abgeschlossener und positiv bewerteter: Die fiktiven weiblichen Figuren erleiden die Krise des Übergangs. Die neue Norm der sexuellen Freiheit erscheint aber nun keineswegs im Text als Befreiung: Die Figuren in der Phase des historischen Übergangs erleben sie, bewußt oder nicht bewußt, als von außen auferlegten Zwang, die normative Forderung nach Freiheit im Sexuellen wird als Leistungsdruck erfahren:
daß man eben als Frau
den Auftrag spürt
diesen Anforderungen zu genügen
und es nicht schafft (S. 42);
oder:
ich hab noch nie einen Mann da angefaßt
vorher niemals
es hat mich erstmal abgeschreckt
und angeekelt
ich hatte auch gar kein Bedürfnis danach
und wollte angefaßt werden
und nicht umgekehrt
und der wollte daß ich ihn anfasse
und nahm meine Hand
und hat sie da hingelegt
und da hab‘ ich ihn angefaßt (…) (S. 41)
Dementsprechend scheitert die Glückserwartung: Die Transformation eines negativ-defizienten Zustands in einen positiv-erfüllten Zustand bleibt aus. Die Tätigkeit der Selektion und Kombination durch die Autoreninstanz manifestiert sich denn auch vom ersten Text an darin, daß einerseits positive Bewertungen sexueller Erfahrung schon quantitativ in den Texten nicht dominant sind und qualitativ sich eher am Anfang als am Ende des jeweiligen Textes finden. Und andererseits zeigen die Texte eine deutliche Tendenz, daß, sofern sich die Fragmente der realen Sprecher überhaupt jeweils zur Suggestion einer kohärenten Geschichte organisieren, fast nur negativ verlaufende erotische Beziehungen erzählt werden. In der Manipulation der realen Redefragmente durch die Autoreninstanz erscheinen dann also positive Bewertungen sexueller Erfahrung bestenfalls als anfängliche und in der Folge falsifizierte, letztlich also als Selbsttäuschungen der Subjekte:
und da saß ich neben ihm
haben uns angeguckt
und es war unglaublich
das war also wirklich
das war wie ein Rausch von Glück
wir verliebten uns also Hals über Kopf
aber auf einer Ebene
die nicht der Realität entsprach (S. 39)
Die Beziehungen, von denen die fiktiven Geschichten erzählen, werden immer in einer Vergangenheit situiert, sie sind, ob die Erfahrung positiv oder negativ war, immer schon abgeschlossen, sie waren also entweder kurzfristige Beziehungen oder gar nur einmalige Begegnungen. Die erhoffte Transformation gelingt also, wenn sie überhaupt gelingt, nie auf Dauer: Im Falle des Gelingens wie des Mißlingens führt der Versuch der Zustandsveränderung durch Sexualität zum Wiederholungszwang, zur immer wieder erneuten und immer wieder enttäuschten Hoffnung. Latentes Unglück charakterisiert also die Erfahrung der Sprecherinnen; die problematische und mißlingende Beziehung wird von der Autoreninstanz zur typischen und repräsentativen Erfahrung erhoben.
Dieses Mißlingen hängt nun mit den Merkmalen der dargestellten Sexualität zusammen. Das Paar stellt sich immer, im jeweiligen Text nur mehr oder weniger akzentuiert, als eine Relation zwischen einem, der beherrscht, und einem, der sich unterwirft, dar, wobei in der Regel die Frau der sich unterwerfende Partner ist, der diese Unterwerfung durchaus als ambivalent erlebt, wie die Rede der Autoreninstanz schon in der Titelgebung verdeutlicht:
UNSEREINER WEISS EINERSEITS
WAS ALLES NÖTIG IST
DAMIT DIE SACHE FUNKTIONIERT
VOR ALLEM EINER DER DOMINIERT
ANDERERSEITS (S. 53)
WER WEISS WESHALB UNSEREINER
ZUR UNTERWERFUNG GETRIEBEN WIRD
UND DEN UNTERWERFER DAMIT ZWINGT
UNSEREINEN ZU UNTERWERFEN (S. 59)
Schon das „andererseits“ des Titels von S. 53 signalisiert die Ambivalenz der Einstellung zur Unterwerfung: Sie ist gewünscht, aber sie ist es eben doch auch nicht. Der Titel von S. 59 hingegen verdeutlicht die Relation von Herrschaft und Unterwerfung in ihrer Ambivalenz: Jede der beiden möglichen Rollen erscheint als fremdbestimmt; der Unterworfene wird „zur Unterwerfung getrieben“ und „zwingt“ damit zugleich den anderen zur Herrschaft. Die Verteilung von Herrschaft und Unterwerfung auf die Partner fällt sowohl im Redeakt der fiktiven Sprecherinnen wie der Autoreninstanz mit den traditionellen Konzeptionen der Geschlechterrollen zusammen:
Und das war gut ich war ruhig
Da hab’ ich zwar geweint
aber ich war erleichtert
weil er hat da mal gezeigt
dass er ein Mann ist
Stärke und Kraft (S. 60)
Wie die realen Redefragmente im Text kombiniert sind, werden zunächst die traditionellen Geschlechterrollen bestätigt. Der Mann dominiert und übernimmt die Aktivität bei der Sexualität, die Frau unterwirft sich und läßt passiv mit sich machen. Der Mann ist es denn auch, von dem ein technisches Wissen erwartet wird:
er war wahnsinnig einfühlend
er hat genau gewusst, was ich brauche
und wie ich reagiere und so (S. 53)
Doch manifestiert sich auch hier eine Ambivalenz; neben dem dominanten Merkmal der Akzeptiertheit der alten Geschlechterrollen meldet sich zugleich ein latentes Unbehagen an ihnen:
man muß sich hier immer als
auch da
und immer als zweitrangiges Wesen benehmen
weil es wahnsinnig schön war
daß der Mann
daß er für mich Autorität war
weil er einfach da war
der eine Herr
der also die dominierende Rolle spielt
der konnte all all
die anderen Sachen machen
und das Mädchen das muß dann eben
ich hatte
mich führen lassen (S. 53)
Und wenn dann etwa der in den neuen Normen mögliche Rollentausch – aktive Frau und passiver Mann – dargestellt wird, dann beschreibt dies ebenso die Autoreninstanz –
WIE UNSEREINER ALS MANN MÄNNER RAUSWIRFT (S. 67) –
Als auch die fiktive Sprecherin als Übernahme der Rolle des je anderen Geschlechts:
ich hab’ dann gesagt
ich wollte mit ihm schlafen
ich fand das toll zu sagen
komm jetzt
tun wir das
ich hab’s einfach getan
daß ich mich wirklich aggressiv verhalten hab’
also wie man erwartet
dass Männer sich verhalten
er ist auch drauf eingegangen wie ein Mädchen (S. 67)
Extremform des traditionellen sexuellen Rollenverhaltens ist denn im Text auch die immer wieder umspielte sadomasochistische psychische Komponente; physisch symbolisiert wird sie in dem im Band rekurrenten Thema der Vergewaltigung.
Aber nicht nur bezüglich des Zwangs tradierter Geschlechterrollen ist hier der Übergang zur neuen Norm der Freiheit noch nicht vollzogen: Von den in der bekannten „Aufklärungsliteratur“ der frühen 70er Jahre, des unnütz berühmten Oswald Kolle und seinesgleichen, empfohlenen neuen Techniken und Praktiken findet sich in der Rede der Sprecherinnen so gut wie keine Spur. Sexualverhalten, das gemessen an den traditionellen Normen als abweichend klassifiziert werden kann, findet sich in den Texten praktisch nur als Wunsch männlicher Partner (vgl. z. B. S. 51 f. oder S. 70) und wird von den Frauen nur als aufgezwungenes Verhalten akzeptiert:
und hat mit mir die fürchterlichsten
also für mich
wie ich’s empfunden hab’
die fürchterlichsten Sachen gemacht (…)
alles alles kreuz und quer
vorne und hinten
und oben und unten
und ich dachte das kann doch nicht sein
noch nie war so was gewesen (…) ( S. 61).
Der Titel So eine Freiheit – und seine leitmotivischen Wiederholungen in der Rede der Sprecherinnen – steht also in Opposition zu den dargestellten Erfahrungen der Frauen. Die versprochene Freiheit kann nicht gelebt werden und erscheint nur als neuer normativer Druck. Explizit und bewußt in den Titelgebungen der Autoreninstanz, implizit und eher nicht bewußt in den Reden der fiktiven Sprecherinnen ist Sexualität in unseren Texten nie sie selbst, sondern immer eine von sich entfremdete; zitieren wir einige der Titel:
WARUM KANN ES SICH UNSEREINER WEDER LEISTEN
EINFACH NUR SO GENOMMEN ZU WERDEN
OHNE DASS ETWAS BESTIMMTES GELEISTET WIRD
NOCH SICH NUR SO HINZUGEBEN
OHNE BESTIMMT ZU WISSEN
UNSEREINER KÖNNTE SICH AUCH NACHHER NOCH LEISTEN
LEISTUNGEN ZU FORDERN (S. 39)
SO ODER SO MUSS UNSEREINER BEZAHLEN (S. 62)
UNSEREINER VERSUCHT JETZT WIE EIN MANN
ZU DENKEN UND ZU HANDELN
UND ZWAR GEMEINSAM ÖKONOMISCH MIT IHM
UND GAR NICHT PRIVATISTISCH (S. 74)
SCHLIESSLICH RINGT SICH UNSEREINER ZUM ERFOLG DURCH
UND WILL IM PARTNER DEN MITARBEITER
AN DER BEFRIEDIGUNG DER BEDÜRFNISSE ERKENNEN (S. 77)
UNSEREINER ZWINGT UNSEREINEN ZUR LEISTUNG (S. 80)
Die Struktur der Sexualität ist also, wie die Autoreninstanz sie deutet und verdeutlicht, durch ökonomische Kategorien bestimmt: „leisten“ und „Leistung“, „bezahlen“, „ökonomisch“, „Mitarbeiter“, „Befriedigung der Bedürfnisse“. Das aber heißt mit anderen Worten, daß die Struktur des überindividuellen Systems zugleich auch das Modell der Struktur der individuellen Beziehungen abgibt. Sexualität erscheint als ökonomischer Tausch, bei dem die Leistungsbilanz ausgeglichen sein muß; die erwartete Gegenleistung für die „Hingabe“ besteht freilich nicht mehr, wie etwa in den Filmen der Adenauer-Ära noch fast selbstverständlich, in einer gesicherten wirtschaftlichen Position und in sozialem Aufstieg, sondern – und hier wird nun tatsächlich der sich um 1970 abzeichnende Wandel der Konzeptionen von Sexualität und Geschlechterrollen greifbar – in sexuellen und emotionalen Werten. Sexualität ist im Text aber nicht nur ökonomischer Tausch, sondern auch symbolischer Tausch: Medium einer non-verbalen Kommunikation, in der man sich ausdrückt und dem anderen etwas ausdrückt. Das Mißlingen der Sexualakte ist Zeichen der mißlingenden Beziehung. Die ihrer selbst entfremdete Sexualität, die Medium für anderes wird, charakterisiert Mann wie Frau:
die haben sich mordsmäßige Mühe gegeben
aber so ohne
ich hab’ genau gemerkt
die wollen nicht mich
die wollen auch alle die Dinge nicht
die wollen nur
natürlich
daß die Frau doch die untergeordnete Rolle
spielen soll
Mittel dazu zu sein
Medium
als Weg zum Erfolg (S. 81)
Die Sexualität der Sprecherinnen erscheint geprägt von der Erfahrung einer zweifachen Dissonanz: der Dissonanz zwischen Erwartung an die Sexualität und faktischer Realisation der Sexualität, der Dissonanz zwischen eigenen Einstellungen und unterstellten neuen theoretischen Normen, deren Geltung angenommen wird, deren Träger aber anonym bleibt, da im Text kein System und keine Person auszumachen sind, die diese Normen setzen würden; ihre angenommene Existenz ist also eine Form der Fremdbestimmung, die sich letztlich das Subjekt selbst auferlegt. Die Dissonanz zwischen Person und von ihr präsupponierter Norm charakterisiert sowohl die Frau als den Mann:
wollte ich mir beweisen
ich bin eine richtige Frau
die immer einen Orgasmus kriegt
wie in der Börse
daß man da steigt
daß man im Wert steigt (S. 80)
und sie haben gemeint
sie müßten Sachen mit mir machen
wo ich genau gemerkt hab’
die wollen die ja gar nicht mit mir machen
die wollen das ja nur machen
aus Prestigegründen
damit ich vielleicht hinterher sagen kann
das wären aber gute Liebhaber oder so (S. 80)
Beide Male übt die Person aus, was ihr nicht Bedürfnis ist, weil sie eine entsprechende soziale Erwartung unterstellt. Die redensartliche Verwendung von steigernden Adverbien wie „unheimlich“ wird im Kontext semantisch refunktionalisiert; entgegen der Intention der Sprecherin gewinnt das Lexem in solcher adverbialer Verwendung seine ursprüngliche Bedeutung zurück:
ich bin unheimlich frei (S. 80)
Die unaufgelösten Dissonanzen resultieren dann tendenziell in einer paradox-perversen psychischen Struktur:
WIE UNSEREINER SICH IN DER KÄLTE
WARM EINRICHTEN MUSS
UND DIE LUST GENIESSEN MUSS
NICHT ZU LEIDEN (S. 68).
Für den zeitgenössischen Leser, der durch die Erfahrungen der Emanzipations- und Sexismusdebatten der 70er und 80er Jahre gegangen ist, präsentiert sich So eine Freiheit zunächst mit höchst unangenehmem Beigeschmack; in der Collage der Redefragmente durch die Autoreninstanz scheinen die Sprecherinnen desavouiert und denunziert zu werden. Frauen sind es, anhand derer die Nicht-Bewältigung der neuen Situation der Sexualität illustriert wird; sie sind es, die weitgehend der traditionellen Geschlechterrolle verhaftet bleiben; sie sind es, die weitgehend scheinen:
und ich dachte ich wäre frigid oder impotent
oder ich wär’ gar keine richtige Frau (S. 68)
Aber es gilt nicht nur im Text, daß immer wieder auch Männer als emotional oder sexuell unzulänglich erscheinen und, wie die obigen Zitate zeigen, ebenfalls eine entfremdende Sexualität erfahren und die Dissonanz zwischen eigenem Wunsch und norm- und fremdbestimmtem Tun leben. Denn So eine Freiheit ist vor allem durch die auffällige Opposition zwischen Titelgebungen der Autoreninstanz und faktischen Sprechsituationen der Texte charakterisiert. Während schon nach der Vorgabe der „Vorbemerkung“ in den Texten dieses Teils nur weibliche Sprecher auftreten, wird in den Titeln, wie die vielen bislang zitierten Beispiele schon belegen, grundsätzlich und ausnahmslos von „unsereinem“ gesprochen. Diese – die männliche – Sprachform wäre nun aber grammatisch nur genau dann legitimiert, wenn die Sprecher entweder männlich oder geschlechtlich gemischt wären, nicht aber dann, wenn sie, wie hier, ausnahmslos weiblichen Geschlechtes sind. Nun gibt es aber zudem sogar textintern die grammatisch korrekte Alternative: sowohl in Preislied (S. 21) wie vor allem in Verirrhaus (S. 119, 121, 147, 149, 150) wird, wenn es sich um eine eindeutig weibliche Sprecherin handelt, die Form „eine von uns“ gewählt. Die Wahl der männlichen Form im Titel bei weiblichen Sprechern im Text muß also funktional sein. Sie kann aber in diesem Kontext offenkundig nur eines bedeuten: Was explizit von Frauen über Frauen gesagt wird, muß implizit den Anspruch haben, Aussage auch über Männer zu sein, wobei in jenem „unsereinem“ auch die Autoreninstanz sich selbst inkludiert. Damit sind freilich zugleich zwei Fragen verbunden. Wenn dargestelltes Sexualverhalten noch weitgehend durch tradierte Rollenklischees strukturiert ist, dann fragt sich erstens, in welchen Punkten und auf welche Weise, was an Frauen illustriert wird, auf Männer transponiert werden kann. Übertragbar sind offenkundig die Erfahrungen der zweifachen Dissonanz, der ambivalenten Einstellungen zu Rollenerwartungen, der Strukturen der Sexualität in ihren Merkmalen der komplex-ambivalenten Dynamik von Herrschaft und Unterwerfung, der Selbstentfremdung, des ökonomischen und symbolischen Tausches. Später, imFalschen Buch, erhält die Transponierbarkeit von einem Geschlecht auf das andere noch ein zeichenhaftes Korrelat in den dargestellten Geschlechtstransformationen, die, unter Referenz auf die Ovidschen Metamorphosen, mehrere der Figuren vollziehen. Wenn aber das an Frauen Dargestellte auf Männer übertragbar ist, dann fragt sich zweitens, warum es ausschließlich an Frauen illustriert wird. Daß die Rolle des Trägers dieser neuen Probleme im Text nur durch Frau besetzt wird, mag polyfunktional sein: Zumindest eine Funktion dieser Rollenbesetzung liegt aber wohl darin, daß im kulturellen Wissen der Zeitgenossen die Diskussion über sich verändernde Konzeptionen von Sexualität und Geschlechterrollen zunächst und primär anhand von Situation und Rolle der Frau geführt worden ist, da die Tendenz dieser Veränderungen – zunächst! – ein größeres Ausmaß an Abweichung vom Tradierten auf seiten der Frau zu erfordern schien.
Schon die Probleme der textinternen Sprechsituation, hier also des scheinbaren Widerspruchs zwischen Sprecherangabe im Titel und tatsächlicher Sprecherrolle, verweisen nun aber darauf, daß unsere Texte eben nicht dokumentarische Protokolle, eben nicht einfache Abbildungen scheinbar vorgegebener Realität sind, sondern literarische Texte, und das heißt Texte, deren Verhältnis zu einer hypothetischen Realität in jedem Falle komplex ist und in denen Sprache nicht bloß neutrales Medium und Werkzeug der Mitteilung ist, sondern eine Dimension der Aussage selbst, d. h. eine Auswahl aus den denkbaren und verfügbaren Alternativen der Formulierung, die, als solche, selbst schon interpretierbar und bedeutungstragend ist. Wie die Selektion und Kombination aus den Elementen einer vorgegebenen „Realität“, d. h. hier den Texten realer Sprecher, einen Text diese „Realität“ strukturiert und damit deutet, haben wir skizziert; nachzutragen bleiben aber einige Bemerkungen dazu welchen Status und welche Bedeutung Sprache in den Äußerungen der fiktiven Sprecherinnen der von der Autoreninstanz hergestellten Teiltexte, dank des transformierenden Eingriffes eben dieser Instanz, erhält. Nur zwei Aspekte dieses komplexen Themas seien hier festgehalten.
Gehen wir zunächst von einem Zitat aus:
irgendwie nur eine Vorstellung
daß er da
daß er ein Mann irgendwie na ja
und er hat seine Hose aufgemacht
daß ein Mann irgendwie na ja
ich fand’s fürchterlich
da war ich so
das war so
das war ein
hat da unten so einen Penis
mit dem er da irgendwie (S. 41)
Sprachlich charakteristisch sind nun zum einen die grammatisch unvollständigen Sätze, wie sie sich in Wührs lyrischen Texten (Grüß Gott, Rede) dominant finden, zum anderen die Floskeln der Umschreibung und der Signale der Uneigentlichkeit der Sprachverwendung. Der erste Text von So spricht unsereiner und zugleich von Preislied ist nichts anderes als liturgisch-rituelle Rede aus solchen Redegesten, aus Versatzstücken, die der Überleitung zwischen inhaltlichen Aussagen ebenso wie der Einschränkung, der Relativierung, der Signalisierung von Inadäquatheit und Uneigenheit dienen. Sexualität – etwas also, was zwar von Rede begleitet sein kann, aber primär und dominant auf dem Austausch non-verbaler Signale und dem Vollzug nicht-sprachlicher Tätigkeit basiert – erscheint in unserem Text von vornherein – und, da es ein Text ist, logischerweise – nur als verbalisierte, wobei der Sprechakt über Sexualität nach der Sexualität stattfindet. Die Rede über Sexualität erweist sich nun aber generell als ein Sprachproblem, das sich im Abbruch begonnener syntaktischer Konstruktionen ebenso wie in den Floskeln uneigentlicher Umschreibung als dieses zu erkennen gibt. Der dominant non-verbalen Realität „Sexualität“ gegenüber erweisen sich die entsprechenden Figuren ganz wörtlich als sprachlos: sie verfügen über keine Sprache, in der, nach dem Eindruck des sprechenden Subjektes, adäquat und nicht-uneigentlich über Sexualität gesprochen werden könnte. Sexualität ist somit ein Thema, an dem sich ein Problem der Versprachlichung von Realität exemplarisch manifestiert. Der Erfahrung einer mehrfachen Dissonanz der sprechenden Figuren in der Realität überlagert sich die Erfahrung einer Dissonanz zwischen erlebt-realer Faktizität und sprachlichem Potential. Wer hier über Sexualität spricht, spricht also über sie nach und außerhalb ihrer Erfahrung: Derjenige, der redet, ist nicht genau derselbe, der erlebt. Es ist freilich eine Trivialität, daß, wer in Rückblick oder Erinnerung über sich selbst spricht, sich dabei verdoppelt und als ein neues und anderes Ich, das mit dem erlebenden Ich nicht mehr identisch ist, außerhalb seiner tritt. Doch kommt hier zu dieser trivialen diachronen Verdoppelung des sprechenden Ichs eine nicht-triviale, synchrone Verdoppelung des Ichs hinzu, in der sich eine Selbstentfremdung artikuliert. Ein Beispiel muß ausreichen; wiederum übernimmt die Autoreninstanz in der Titelgebung die Verdeutlichung oder Deutung des vorgegebenen Sprachmaterials, das sie zu Texten macht:
WARUM HAT UNSEREINER ES GERN
WENN JEMAND BEI UNSEREINEM ERFOLG HAT (S. 47)
Wir können sprachlich zwar sagen, daß wir bei jemandem Erfolg haben, aber wir können nicht sagen, daß jemand bei uns Erfolg hat. Wenn Ego sagt, daß Alter bei ihm Erfolg hat, dann nimmt Ego eine mögliche Wahrnehmungs- und Redeperspektive ein, die nur die Alters sein kann. In seiner Selbstwahrnehmung ist Ego hier also nicht einfach Ego, sondern Ego erfährt sich aus der Perspektive von Alter. In seiner Sprache ist Ego also nicht bei sich: Wenn es sich artikuliert, nimmt es die Perspektive Alters ein, d. h. wenn Ego über sich spricht, manifestiert sich in seiner Sprache seine Selbstentfremdung und Fremdbestimmtheit: Der oder das Andere, mit dem Ego in Sexualität oder Drogenkonsum in Kontakt tritt, wird Teil des Selbst und Ego versteht sich von vornherein nur in dieser Abhängigkeit vom Anderen. Die beiden Aspekte des Sprachproblems sind korreliert: Bei Verwendung der „normalen“ und „eigentlichen“ Sprache wird die Realitätserfahrung des Selbst jedes Mal deformiert und fremdbestimmt; wenn überhaupt, so könnte in der Logik dieses Textsystems Realität adäquat wiedergegeben und ein nicht fremdbestimmtes Selbst konstituiert werden nur in einer Sprache, die eine nicht-„normale“, das hieße, eine „literarische“ und „uneigentliche“ ist.
In So eine Freiheit ist aber nun genau dieses sprachliche Scheitern – daß die Sprache gegenüber der Realität inadäquat erscheint und daß das sprechende Ich sich in seiner Sprache selbst verfremdet – die adäquate Darstellung von Realität und Selbst. Daß aber das sprachliche Scheitern zum sprachlichen Gelingen wird, ist eben Produkt nicht der vorliterarischen Rede realer Subjekte, sondern der sie transformierenden Rede der Autoreninstanz, die fiktive Subjekte sprechen macht. Auch hier also ist es in der Tat die literarische Transformation nicht-literarischer Rede, die in der Transformation des Gegebenen überhaupt erst dessen adäquaten Ausdruck herstellt.
Soweit unser Beispiel. Ausgehend von ihm seien nun – postulativ und approximativ – einige Prinzipien der Poiesis im Werke Wührs skizziert. Zunächst: Warum der Poiesis und nicht der Poesie? Unsere Thesen sollen, hoffen wir, in der Folge immer wieder illustrieren, daß in den Texten Wührs das „Gemachte“ nicht die hierarchisch höchste Ebene des Textes ist, sondern daß der Akt des „Machens“ dem „Gemachten“ nicht extratextuell vorausliegt, sondern das Thema des „Gemachten“ ist. Genetisch ist der Akt des Produzierens vom Produkt verschieden und in ihm nicht enthalten; logisch-semantisch ist das Produkt hier die Thematisierung eines Aktes des Produzierens. Tatsächlicher, biographisch-genetischer Akt des Produzierens und fingierter logisch-semantisch repräsentierter Akt des Produzierens sind natürlich nicht identisch: Aussagen über die reale Genese können logischerweise nicht aus den Texten selbst abgeleitet werden; aus den Texten selbst abgeleitet werden können hingegen Aussagen über die gedachten Probleme der Genese
literarischer Rede.
Aus allen Texten des Wührschen OEuvres im Untersuchungszeitraum läßt sich jeweils interpretatorisch ein logisch-semantisches System abstrahieren; wir haben diese Operation am Beispiel von So eine Freiheit angedeutet. Nach unserer Behauptung liegt nun all diesen Texten bzw. den aus ihnen logisch-semantisch abstrahierbaren Systemen ein gemeinsames System von Problemen und Prinzipien zugrunde, aus dem heraus sie in der gedanklichen Simulation interpretatorischer Rekonstruktion generierbar wären, akzentuiert und hebt als dominant hervor verschiedene Komponenten eben dieses invarianten Systems.
1. Kein Text Wührs hat ein eindeutig hat ein eindeutig identifizierbares Thema. Jeder der durch die expliziten Aussageninhalte gesetzten Themen ist immer nur eines neben anderen. So koexistieren z. B. – neben vielen anderen – in Gegenmünchen, in So spricht unsereiner, in Rede, in Das falsche Buch erotische und politische Themen. In der Rede etwa, dem bisherigen Höhepunkt Wührscher Lyrik, koexistieren etwa Referenzen auf das gegenwartsgeschichtliche Thema der Pariser Studentenunruhen vom Mai ’86 und die historische Referenz auf das Thema der Französischen Revolution, das Thema erotischer Beziehungen, das Thema von natürlicher temporaler Zyklik der Jahreszeiten und ihrer rekurrenten Prozessen von Werden und Sterben in Opposition zur nicht-zyklischen, linearen Lebenszeit des Menschen zwischen Geburt und Tod, das Thema der Einbettung des Menschen in astronomische, physikalische, chemische, biologische Strukturen. Keines der Teilthemen ist das dominante und integrative, wie die Erstrezensenten glaubten. Dominant und integrativ kann logischerweise allenfalls sein, was, „horizontal“ gesehen, die Teilthemen korreliert bzw., „vertikal“ gesehen, ihnen als invariante Gemeinsamkeit übergeordnet ist. Das aber ist immer das Problem des Aktes dichterischen Sprechens. Die auffällige Omnipräsenz des Teilthemas Erotik/Sexualität erklärt sich in dieser Perspektive dadurch, daß dieses Thema nie nur es selbst ist, sondern zugleich immer anderes repräsentiert.
2. Jeder Sprechakt im Werke Paul Wührs ist ein indirekter und verfremdender. Wo scheinbar – d. h. direkt und explizit – über ein Thema x gesprochen wird, wird faktisch immer – indirekt und implizit – über ein Thema non-x gesprochen, und die Sprache dieses Sprechens liefert die Indikatoren, daß die scheinbar eigentliche Rede über x faktisch uneigentlich Rede über non-x ist. Wo explizit in So eine Freiheit weibliche Sexualität das Thema ist, ist es implizit auch männliche; wo Sexualität überhaupt das Thema ist, ist es implizit das Problem der Relation zwischen einem überindividuellen System in Krise und Wandel und den Situationen der einzelnen Individuen. Und wo in diesem Werk überhaupt die Rede von einem inhaltlichen konkreten Thema zu sein scheint, sei dies nun Sexualität oder Politik oder …, ist faktisch immer die Rede von den Problemen der Poiesis: Nur diese sind das dominante und integrative und invariante Thema dieser Texte. So spricht unsereiner führt implizit vor, wie aus einer Realität (= Menge realer Texte) ein fiktiver und literarischer Text wird.
3. Wo der Akt des Produzierens das zentrale Thema des Produktes ist, da ist notwendig die in den Texten aufgebaute, d. h. textinterne und fiktive Sprechsituation eine Struktur von zentraler Relevanz, wie verschieden diese Sprechsituationen im Einzelfalle auch sein mögen. Nicht zufällig werden bei drei der Texte Redeakte und Sprechsituationen schon im Titel thematisiert: In So spricht unsereinerakzentuiert der Titel die fiktiven Sprecher, in Grüß Gott ihr Mütter ihr Väter ihr Töchter ihr Söhne akzentuiert er die fiktiven Adressaten, und beide Male ist es im übrigen jedermann, in der Rede ist es der Inhalt bzw. der Akt des Sprechens selbst, der akzentuiert wird. In Gegenmünchen wie in So spricht unsereiner bleibt jeweils der Sprecher des Gesamttextes, d. h. die Instanz, die textintern das Äquivalent des textexternen Autors ist, anonym und manifestiert sich greifbar nur in der titelgebenden und somit freilich strukturierenden und deutenden Tätigkeit; in Grüß Gott, in der Rede, im falschen Buch wird diese textproduzierende Instanz als Ich-Sprecher personalisiert. Immer aber gibt es, sei er nun sprachlich gegeben oder nur erschließbar, den, der da redet oder reden läßt, letzteres am deutlichsten im Falschen Buch, wo der Ich-Sprecher des Textes die anderen, eingebetteten, ihm untergeordneten Figuren, und das heißt immer auch Sprecher, aus sich entläßt und in sich zurücknimmt, Akte, die im Text Akten des Zeugens und Gebärens einerseits, Akten des Tötens oder der Rückkehr in den mütterlichen oder väterlichen Ursprung andererseits äquivalent sind.
4. Der Akt des Redens der obersten Sprechinstanz des jeweiligen Textes ist jedes Mal, mehr oder weniger deutlich akzentuiert, in zweifacher Hinsicht mit Sexualität korreliert. Sexualität ist einerseits immer Thema, und der Akt des Redens ist andererseits tendenziell immer auch einem Sexualakt äquivalent. Jene „Rede“, deren Thema sie selbst ist, spricht nicht nur über Sexualität, sondern der Akt des Redens wird selbst sexualisiert. Das, worüber sie spricht, ist sie, uneigentlich und metaphorisch, zugleich selbst: ein Körper mit allen seinen Funktionen:
SO REDET DIE REDE sie ist dabei
ihr linkes Bein zu heben als
das rechte steht wobei
die rechte Brust abhängen muß
als ihre linke steigt wer weiß
der Baum
bleibt stehen als die Hinterbeine
dieser Rede sinken wie wenig
erhaben
das Loch die Wörter ins Leere
abschlägt
(Rede, S. 47)
Die Figuren im Falschen Buch üben nicht nur Sexualität aus, sie sprechen nicht nur über sie, sie sind nicht nur in der fiktiven Realität Produkte von Sexualakten, sondern sie erscheinen zugleich als Produkte einer metaphorischen Sexualität des übergeordneten Ichs, das als Sprecher des Gesamttextes fungiert.
5. In verschieden deutlicher Akzentuierung wird in den Texten – real oder fiktiv – mündliche Sprache in schriftliche Sprache oder non-verbale Realität in sprachliche Realität transformiert. In So spricht unsereiner wird aus Tonbandaufnahmen realer mündlicher Sprache schriftliche; im Falschen Buch wird die fiktive mündliche Sprache der Figuren schriftlich vertextet, was schon, weniger klar akzentuiert, das Prinzip von Gegenmünchen war. Bis in die Titel hinein erhalten die Textsammlungen So spricht unsereiner, Grüß Gott, Rede den Anspruch ursprünglicher Mündlichkeit aufrecht. Am Thema der Sexualität, wir haben es am Beispiel von So eine Freiheit skizziert, wird immer genuin non-verbale Realität versprachlicht. Beiden Operationen – der des Mündlichen ins Schriftliche und der Überführung des Non-Verbalen ins Verbale – liegt immer die Differenzerfahrung, d. h. Unterschied und Opposition zwischen Ausgangs- und Endzustand zugrunde, und diese Differenzerfahrung wird in den Texten immer explizit oder implizit thematisch und zudem funktionalisiert. In der Manipulation realer Rede durch die Autoreninstanz in So eine Freiheit sind die abgebrochen-unvollständigen Sätze einerseits Indikator ursprünglicher Mündlichkeit, andererseits aber zusätzlich semantisiert als Indikator der Probleme des Sprechens über diese Rede. Wo Wühr, wie im Hörspiel Preislied, einen ursprünglich schriftlich-literarischen Text, der seinerseits einen mündlich-nichtliterarischen Text präsupponiert, nochmals transformiert, kehren dann, statt der ursprünglich non-verbalen Signale mündlicher Rede neue, fiktive, non-verbale Elemente wieder, hier etwa Stimmlage und Intonation der einzelnen Sprecher und begleitend-alternierende Musikeinlagen. In Soundseeing Metropolis München schließlich dominieren von vornherein die non-verbalen, akustischen Elemente, die sich als Analogon einer Partitur organisieren.
6. Wührs Texte haben von vornherein die Tendenz zur Multimedialität. Systeme der graphischen Anordnung und der Schrifttypen und topographischen Skizzen wie in Gegenmünchen – erinnert sei auch an den Lageplan im Falschen Buch –, die Überlagerung von Gattungen, wie sie das Falsche Buch illustriert, und der zunehmende Anteil anderer Medien, wie sie die Entwicklung des Wührschen Hörspiels von Preislied zu Soundseeing Metropolis München demonstriert, belegen dies. All diesen Wührschen Formen liegt aber nicht eine Tendenz zur Medienkooperation zugrunde: Es handelt sich um eine sprach- und textinterne Tendenz; die sprachliche Realitätsbewältigung bringt aus sich selbst die Multimedialität hervor, insofern einerseits die Texte selbst, in ihrer Bezugnahme auf andere Texte, in der Rekurrenz leitmotivischer Elemente, in ihrer Neigung zu rhytmischer Phrasierung zu Formen liturgischer und oratorienhafter Rede tendieren, insofern andererseits das präsupponierte, sprachlich nicht abbildbare, aber als relevant gesetzte non-verbale Element eine adäquate, wenn auch immer schon transformierende Wiedergabe nur mit außersprachlichen Mitteln finden kann.
7. Wührsche Texte sind grundsätzlich durch Strukturen der Intertextualität charakterisiert, d. h. sie sind Texte, die auf andere Texte Bezug nehmen und diese voraussetzen, wobei der Bezugspunkt dieser Textreferenz ebenso ein realer wie ein fingierter Text eines anderen Sprechers sein kann. In So spricht unsereiner sind die zitierten Texte außerliterarische Texte realer Sprecher, in der Rede oder imFalschen Buch wimmelt es von Zitaten prominenter literarischer oder nicht-literarischer Texte; noch in Soundseeing Metropolis München liegen wiederum Tonbandaufnahmen zugrunde, d. h. zitierte Tonereignisse nicht-sprachlicher oder sprachlicher Art. In Gegenmünchen wie im Falschen Buch behauptet die – im ersten Fall anonyme, im zweiten Falle personalisierte – Sprechinstanz, Äußerungen anderer – diesmal fingierter – Sprecher wiederzugeben. Wührs Texte sind also tendenziell immer Metatexte: Texte, die sich auf fiktiv oder real vorgegebene Texte beziehen und aus diesen und über diesen neue Texte konstruieren. Sie leisten dabei ein Doppeltes: Sie rufen die präsupponierten Texte und ihre Bedeutung ab und stellen sie zugleich in den neuen Bedeutungskontext der eigenen Rede; so exemplarisch der Eingangstext von Grüß Gott:
Ich habe den Fehler nicht
machen müssen weil
der sagt
ich bin der Fehler
der ich bin
lasset uns den Fehler machen
ein Bild
das uns gleich sei
(GG, S. 5),
wo die oberste Sprechinstanz die jüdisch-christliche, göttliche Schöpfung des Menschen wie die christliche Selbstdarstellung des Erlösers abruft, aber zugleich – durch das Stichwort „Fehler“ – blasphemisch transformiert. Der da spricht, stellt sich also einerseits in den Kontext einer Rolle des Schöpfers und Erlösers, von der er sich zugleich distanziert, aber nicht ohne damit die Rolle des Schöpfers und Erlösers umzuinterpretieren.
8. Jene ‚Realität’ also, die Wührsche Texte zu behandeln vorgeben, ist, fiktiv oder real, tendenziell immer eine schon sprachlich präformierte. Die ‚Realität’, die sich etwa in So eine Freiheit abzeichnet, ist schon die Verbalisierung einer Erfahrung ursprünglich non-verbaler Sachverhalte. Diese ‚Realität’ ist also überhaupt nicht außerhalb der vom Text präsupponierten Sprechakte gegeben: Wenn alle Figuren im Falschen Buch das Produkt einer Sprechinstanz sind, die sich, wenn sie sie „gezeugt“/„geboren“ hat, mit ihnen, als mit ihresgleichen auf derselben Ebene, unterhalten kann, dann ist die von den Texten fiktiv präsupponierte ‚Realität’ immer nur etwas, was erst Produkt von Sprechakten – und nur als solches gegeben – ist. ‚Realität’ außerhalb und vor Sprechakten erscheint für sprachliche Rede und für Literatur als ‚black box’ und bleibt ihr unzugänglich, sie kann allenfalls, siehe oben, mit Hilfe anderer Medien zwar nicht abgebildet, aber bedeutet werden. Daß aber ‚Realität’ immer nur Rede über ‚Realität’ in diesen Texten ist, daß also ‚Realität’ als Größe, mit der man sich auseinandersetzen und über die man sprechen kann, überhaupt nur in Sprechakten sich konstituiert, ist die Voraussetzung des Verständnisses jener Kategorien- oder Ebenenkonfusion, bei der von bloß sprachlicher Existenz einer Größe zu deren realer Existenz übergegangen wird:
Jetzt weiß ich nicht mehr
habe ich den Rehrücken
auf dieses Blatt geschrieben
oder ist er aus ihm
ganz einfach aufgetaucht
oder habe ich ihn
selber draufgelegt
oder soll ich ihn essen
(GG, S. 14)
Anscheinend ist es verboten, dieses Buch zu schreiben, sagte ich.
Das stimmt tatsächlich, sagte der eine.
Das ist nicht nur anscheinend so sagte, der andere.
Tatsache ist, daß ich dieses Buch bereits schreibe, sagte ich. Sie beide
kommen darin vor. Ich schreibe jetzt, daß einer von ihnen sagt:
Hier ist eine Absperrung, gehen Sie endlich weg, sagte der eine.
(FB, S. 31)
Im ersten Zitat wird also aus dem sprachlich gesetzten Rehrücken plötzlich ein real existenter („draufgelegt“) und sogar konsumierbarer („soll ich ihn essen“); im zweiten Zitat wird zunächst scheinbar als ‚Realität’ gesetzt war, in etwas transformiert, das nur geschrieben ist, in diesem Schreiben entsteht, nur in ihm existiert, um dann erneut, nunmehr aber als bewußte literarische Fiktion, als ‚Realität’ gesetzt zu werden. ‚Realität’ ist also das Produkt von Redeakten.
9. Die Redeakte Wührscher Texte sind somit performative Sprechakte, d. h. Sprechakte, bei denen jene ‚Realität’, über die zu sprechen sie vorgeben, erst durch eben diese Sprechakte selbst geschaffen wird: Poiesis im Sinne göttlicher Weltschöpfung – nicht zufällig werden in den intertextuellen Bezugnahmen der Texte immer wieder biblische Denkmodelle anzitiert, im oben zitierten Eingangsgedicht vonGrüß Gott ebenso wie in der Abrufung des sprachlichen Pfingstwunders aus der Apostelgeschichte in der Rede. Die durch den eigenen Sprechakt geschaffene oder zumindest vergewisserte Realität kann dann zum Gegenüber des eigenen Ichs und seines Sprechaktes werden – exemplarisch wird das Prinzip im Falschen Buch vorgeführt, wo die vom Ich geschaffenen Figuren sich verselbständigen.
10. Die Redeakte Wührscher Texte sind zugleich immer selbstreferentielle Texte: indem sie über irgendetwas reden, reden sie über sich, und das heißt: über Möglichkeiten und Bedingungen der Entstehung poetischer Rede. Nicht zufällig trägt der bedeutendste Lyrikband Wührs eben diesen Titel: Rede. Der Titel erweist den Band als Sprechakt, dessen Inhalt er selbst ist. Die poetologische Selbstthematisierung ist aber in der Logik des den Wührschen Texten zugrundeliegenden Systems nicht spielerisch-artistische Selbstgenügsamkeit von Literatur: Wir versuchten, anhand von So eine Freiheit zu zeigen, daß gerade die uneigentliche Sprachverwendung literarischer Rede, wie sie im Wührschen Textkorpus ebenso extrem wie exemplarisch in der Rede realisiert ist, die allenfalls mögliche Form adäquater Rede über das Selbst und über das andere ist; die Rede formuliert zu Recht:
Zu einfach spricht was sich verständlich macht
(Rede, S. 18)
11. Wo also die höchste Sprechinstanz der Texte auf andere – fingierte oder reale – Texte referiert, da macht sie fremde Rede zu eigener Rede; wo diese Sprechinstanz sich fingierte Sprecher schafft, denen sie Rede in den Mund legt, da macht sie eigene Rede zu fremder Rede. Strukturell sind die Texte immer charakterisiert durch eine Polyphonie der Stimmen: Im Monolog wird Fremdes zu Eigenem gemacht, im Dialog Eigenes zu Fremdem; die Opposition von Monolog und Dialog ist immer nur eine scheinbare und wird immer neutralisiert. Denn wenn einer spricht, sind es auf anderer Ebene letztlich mehrere; sprechen aber mehrere, so ist es auf anderer Ebene doch nur einer. So kann denn der Dialog des Textsprechers mit einem absenten Anderen explizit als Monolog des Ich mit sich charakterisiert werden:
Grüß Gott Herr Kafka
werde ich sagen schauns’
hinter sich
weil ich mit dem hinter Ihnen red’
sozusagen über Ihren schweren
Kopf red’ ich mit mir (…)
(GG, S. 75)
Nicht nur apersonale ‚Realität’ außerhalb des Ichs, sondern auch das Ich selbst konstituiert sich überhaupt erst im Sprechakt. Und wie sich die ‚Realität’ aus eigenen und fremden Sprechakten konstituiert, so konstituiert sich das Selbst der obersten Sprechinstanz wie der Figuren, die sie aus sich entläßt, immer als problematisch-instabile Synthese aus dem Eigenen und dem Fremden. In So eine Freiheit sahen wir, wie das sprechende weibliche Ich die Perspektive des anderen in die sprachliche Konstitution seines Selbst einbezieht; schon auf den ersten Seiten des Falschen Buchs entläßt die Sprechinstanz Ich nicht nur aus sich fremde Sprecher, die Nicht-Ich sind und allenfalls vom Ich entworfene Potentialitäten des Ich darstellen, sondern läßt sogar dieses Ich, das sie sprechend hervorbringt, sich in Frage stellen und seine Identität verunsichern (S. 36).
12. Wenn aber Realität und Selbst sich nur im Sprechakt konstituieren und wenn in jedem Sprechakt eigene wie fremde Rede präsent ist, wenn somit der jeweilige Teil- oder Gesamtsprecher sein Selbst immer nur in der Auseinandersetzung mit fremder Rede und also mit dem Selbst eines Anderen implizit definieren und durch den Sprechakt nach außen, in der Abgrenzung zu allen anderen, behaupten kann, dann läuft die Struktur der Texte am Ende immer auf die Frage hinaus: Was ist ein Selbst, sei es mein Selbst oder dein Selbst. In der Struktur des Textkorpus aber gilt, daß die Frage logischerweise nie definitiv beantwortet werden kann. Denn das Ich, das sich in seinen Sprechakten jeweils definiert und behauptet, tritt, wir sahen es am Beispiel von So eine Freiheit, im Redeakt außerhalb dessen, was es war und beschreiben will. Wenn Ich zu sagen versucht, was und wo es ist, dann ist es schon nicht mehr das und dort. Wenn Ich aber gleichwohl eben dieses zu sagen versucht, dann resultiert daraus notgedrungen ein letztlich unabschließbarer Sprechakt. Da Ich in jeder Aussage über sich das nicht mehr ist, was es auszusagen versucht, muß es den Prozeß seiner Selbstdefinition immer erneut beginnen. Und daher, hoffen wir, wird Paul Wühr aus systeminterner Notwendigkeit weiter schreiben müssen – nach seinem eigenen Diktum:
nur so weiter im Wald
(GG, S. 15).
Paul Wühr, Materialien zu seinem Werk
Hg. von Lutz Hagestedt.
München (Friedl Brehm) 1987.
S. 31 – 48