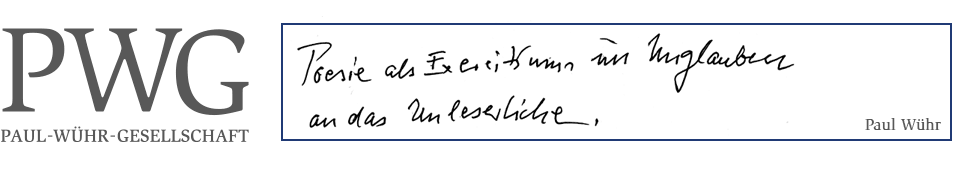Ich bedanke mich für den Franz Carl Weiskopf Preis, der für sprachkritische und sprachreflektierende Werke vergeben wird, die freilich nur im höchsten Eigensinn entstehen, weil Sprache nur mit ihm zum Sprechen zu bringen ist.
*
Einen Poeten zum Sprechen zu bringen, erübrigt sich, es sei denn: er spricht vom Eigensinn der Sprache. Als Bürger kann er sich hoffentlich ausdrücken. Dann kommunziert er. Mit der Poesie hat das aber wenig zu tun.
*
Er kehrt sich als Poet eigensinnig ab von einem bestimmten Sinn. Er teilt nichts Bestimmtes mit. Er bringt nicht eigensinnig sich selber zur Sprache. Diese ist es, die er eigensinnig dazu bringen will: sich so eigensinnig wie nur möglich aufzuführen.
*
Es stellt eine Leistung dar, sich oder andere oder Sachen treffend zu beschreiben. Unter den zur Verfügung stehenden Wörtern wähle der Schreiber das treffende Wort. Vortrefflich ist dann sein Text. Der ist klar. Man versteht. Und zwar gleich. Da hat man dann sofort etwas davon.
*
Hier hat sich die Sprache nicht eingemischt. Sie hatte sozusagen nichts zu sagen. Der Schreiber bediente sich. Was er mitteilen will, schreibt er gewöhnlich in Prosa, und zwar in ganzen Sätzen und bestenfalls ordentlich ausgedacht.
*
Ganze Sätze in einem sogenannten Gedicht allerdings vervielfältigen die Brüche am Zeilenende um genau so viele, wie nötig, um schlampiges Denken literaturfähig zu machen. Soviel für strenge Prosa.
*
Wird Sprache vom Poeten zum Sprechen gebracht, dann ist er selbst nur noch eine Stimme unter vielen: In das, was er sagt, mischen sich viele ein. Die Kommunikation findet in der Sprache statt. Was entsteht, ist ein vielstimmiges Werk. Die Sprache hat hier das Sagen.
*
Stillegungen unterbrechen. Das verursachen Zwischenrufe oder Widerreden, Einsprüche, immer aus Leidenschaft, unerwartet jedenfalls. Der Eigensinn der Poesie stößt mit dem Eigensinn der Sprache zusammen. Nach solchen Zäsuren stockt der Sinnbetrieb. Nichts kann sich sinnvoll anschließen, nichts schließen. Alles bleibt offen.
*
Bilder, gar solche, die gemalt werden können, legen fest. Metaphorik, die aus der Grammatik kommt, schließt nichts ab; sie ist genuin sprachlich. Grammatische Bilder, weil sie sich über dem abgestandenen Sinn bewegen wollen, befreien sich von Ballast. Ein Grund für die Liebhaber konventioneller Metaphorik: von dünnen oder mageren Gedichten zu sprechen. Soviel zur Konditorei in der Literatur.
*
Wird über eine Amsel geschrieben, kann nur mit viel Glück jenseits von Tierkunde der Vogel ein Gedicht ins Fliegen schreiben. Schon beim „schwarzen“ Vogel hebt es nicht ab.
*
Die Mobilität der Poesie stellt sich selbst endgültig als Explosion dar: in der Sprache handelt es sich um Stillegung. Die Figuration, könnte man hier mit einer Metapher übersetzen: ist die Stillstellung der noch in der Sprengung fliegenden Teile eines Hauses in der Luft. Hier komme ich wieder mit dem Eigensinn, dem Plan, der also gewaltsam aufgelöst werden muß. Das lasse ich liegen. Soviel zum notwendigen Mißbrauch, dem sich Poesie verschreiben muß.
*
Wenn sich Poesie wie die Natur – jenseits des Staates – aufführt, so deshalb: in einem Staat muß die wilde, die wahnsinnige, die ungerechte, die vergewaltigende Stimme erinnern daran, was im Rahmen der angemessenen Ordnung immer noch und immer wieder rumort. Poesie jedoch, nicht zu vergessen, schreit, siehe ihre Figuration, immer auch gemessen an der Not.
*
Das figurierte Gebilde „Gedicht“ richtet sich weniger nach politischen Vorbildern: es entwirft vielmehr diese als Schauplätze eines Geschehens in höchster Freiheit, in dauernder Veränderung, geschaffen für die Anhörung höchster Not und größtmöglichen Glücks; hier wird in aller Strenge auf Geschlossenheit verzichtet. Das Neue ist dran.
*
Die Wissenschaft will archivieren, sogar die Philosophie stellt die Unmittelbarkeit des Menschen nach dem Tode endgültig still. Von dieser Stillstellung will Poesie nichts wissen. Sie verändert Totes bis zur Lebendigkeit. Das gelingt nur ihrem Eigensinn. Dort, wo für den Umsprung in allem Leichtsinn ein Brett gedacht werden muß – am Ende einer Zeile, die dafür derart gebaut ist, oder, das Ende der Zeile nicht abwartend, schon viel früher: um, nur kurz aufgehalten, aus der Stille, dann nicht nur zu springen, sondern mit einer Drehung abzufliegen: Das geht durch, in anderen Rollen, mit anderen Ereignissen auch für andere Personen bis zum Ende – das immer nur vorläufig ist.
*
Nicht um ein sogenanntes Gedicht geht es, sondern um viele solche sogenannten Gedichte, die also nicht mehr so genannt sein wollen. Dafür gibt es noch keinen Begriff, noch ist die Sache selbst nicht begriffen. Ich nannte das „res publica poetica“, also einen poetischen Staat.
*
Unser Leben hat keine Gegenwart. Was in ihm geschieht, läuft nicht in der Zeit ab. Ist es derart abgelaufen, dann ist es vergangen. In der Zukunft haben wir nur etwas zu suchen, während wir uns in der Vergangenheit aufhalten. Nur in ihr tut sich dann aber doch vieles. Wir sterben in ihr. Dann, sagt man, sind wir endgültig stillgelegt. Was wir geschaffen haben, übernehmen andere unmittelbar. Für uns gibt es nur noch Mittelbarkeit. Diese wird umgedreht im Poem. Für Tote steht alles fest, sagt man: nichts werde von ihnen verändert. Darauf pfeift Poesie. Ihr Pfiff ist das Signal zur Veruntreuung, zur Entstellung. Nicht nur zur Verhinderung einer Wiederholung alles Identischen, wird das Zeichen gegeben von der Poesie, sondern zur Aggression, zur rückwärts gewandten Revolution. Die Poesie nennt unter erfundenen Umständen die Vergangenheit Zukunft. Sie nimmt aus der Vergangenheit Geschehen, die sie in der Zukunft ablaufen lässt. So geht sie um mit der Zeit. Sie hält sich an keine Inhaltsangabe. Bedeutungen sind das Zeug, mit dem sie spielt: immer gegen die endgültige Stillegung: immer gegen den Tod.
*
Poesie hofft auf eine unsterbliche Vergangenheit, in welcher gegen den ewigen Strich des Schöpfers: Unordnung durch Verdrehung der Fakten, der Biographien, erst recht der Historie angerichtet und insgesamt so etwas angestellt wird, wie Unmittelbarkeit nach dem Tod: ganz außergewöhnlich und so niemals vorgesehen an höchster Stelle.
*
Der Autor teilt sich nicht mit. Ihm soll etwas mitgeteilt werden. Das ist sein Wunsch. Und sollte es etwas Neues sein, gut. Und sollte es mitteilenswert sein auch für andere, kann ihm das nur recht sein.
*
Ich suche eine Bezeichnung für jene Texte, die in einem frühen Zyklus genannten Ganzen vorkommen, also in einem periodisch ablaufendem Geschehen, welche Bedeutung nicht auf meine Ansammlung zutrifft: und hier ist schon das betreffende Wort, nur immer noch nicht die Bezeichnung des Teiles, der sich mit anderen versammelt. Der Staat klingt an, insbesondere seine Repräsentation. Was sich in meinen Ansammlungen trifft, könnte Abordnung genannt werden. Das klingt sehr prosaisch. Aber das stört nicht. Es soll ja nicht lyrisch klingen. Das Gefühl führt Gedanken vor. Die Auseinandersetzungen werden gesungen. Ich bin endlich beim Canto. Dieser bringt nicht nur sich zur Sprache. Er spricht und singt für viele – als quasi Abgeordneter; er ist ein cantus figuralis. Er singt mit vielen Stimmen, weil die Sprache in der Poesie aufgerufen wird, aufgerührt, aufgeweckt. Viele müssen, vieles muß zu Wort kommen, nicht alles, freilich – es wird der Rahmen aber überstimmt werden, da und dort bricht er. So in etwa stelle ich mir, wenn es viele Ansammlungen gibt, ein Poem vor, ein Buch.
*
In einem Buch spricht der Leser mit. Er spricht im Canto als noch ein Sprecher mit einer eigenen Stimme. Es handelt sich darum, den Canto offen zu halten für ihn. Auch hier gilt: ganze Sätze weisen den Leser ab. Die Folge von ganzen Sätzen lässt Mitsprache nicht zu. Und treffende Attribute schränken seinen Umgang mit Unsichtbarem ein. Widerrede wird erschwert. Zugemalte Ansichten prunken mit Sicherheitsvorkehrungen. Der Reim tut das seine: der Rhythmus wird von ihm beherrscht. Dem Leser bleibt nur die vorgeschriebene Weise des Vortrags. Ihm wird die eigene Melodie verweigert. Er bleibt draußen. Er liest nach, er bleibt Nachleser. Erfunden kann hier nichts werden.
*
Schon gar nicht ein neuer Leser, nämlich einer, der sich mit der Lesung eines Canto selber findet, dem sich der Canto ganz erschließt, der also ins Singen gerät und ins Tanzen. Das aber ereignet sich selten. Als wäre, was weiche Gemüter von der Poesie annehmen: diese eine Versschaukel oder Reimwiege. Sie ist aber eine steile Wand, eine Wüste: Lesen als Abenteuer.
*
Das bisweilen „Vision von Ostia“ genannte Gespräch zwischen Augustinus und seiner Mutter, das mir Johannes Kreuzer im Gespräch mit seiner Schrift „Et ecce estante nos“ ans Herz legte, spricht davon: Nur im Verlauten tönender Zeichen sei das „verbum intimum“ da, in dem, was gesprochen wird, unausgesprochen tönend. Schweigen und Sprache, sagt Kreuzer, werden nach Augustinus zusammen gehören. Für ihn spreche Gott im Schweigen. Für Gott setzen viele von uns andere Wesen. Gleichviel: der Canto öffnet sich immer, auch für solche, die im Unausgesprochenen sprechen.
Wir danken Paul Wühr für die Abdruckgenehmigung. Die Rechte liegen beim Autor.